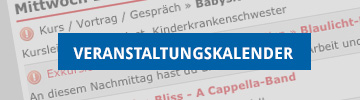Massnahmen, die das Leiden eines Menschen mit einer unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronischen Krankheit lindern und ihm so eine bestmögliche Lebensqualität bis zum Ende verschaffen, fasst man unter dem Begriff «Palliative Care» zusammen. Eine schwere Krankheit ist nicht nur für den betroffenen Menschen eine grosse Bürde auch Angehörige oder Freunde leiden mit und sind oft hilflos.
Das Palliativ Netzwerk Sempachersee möchte mit dem neuen «Palliative Café» ein niederschwelliges, unkompliziertes Angebot für Betroffene, Angehörige, Freunde oder am Thema Interessierte anbieten. Es findet jeweils am 1. Dienstag im Monat, beginnend am 6. Mai, um 14 bis 16 Uhr, im Restaurant Iheimisch in Sursee statt. Es werden drei Fachleute mit Palliativ-Erfahrung vor Ort sein, um allfällige Fragen, Anliegen, Informationen aufnehmen und beantworten zu können.
Patricia Hans ist Co-Leiterin der Pflege Spitex Ruswil mit einem CAS in Interprofessioneller Palliative Care und gehört der Kerngruppe des Palliativ Netzwerkes Sempachersee an. Sie ist eine der Initiantinnen des «Palliative Café».
Was ist Palliative Care genau?
Es geht um die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und ihren Angehörigen. Die Aufgabe von Palliative Care ist, Leiden vorzubeugen und zu lindern. Dabei geht es auch um frühzeitiges Erkennen von körperlichen und seelischen Beschwerden. So, dass die Lebensqualität durch medizinische, spirituelle oder psychologische Ansätze verbessert werden kann. Wichtig: Es dreht sich nicht immer alles um den Tod. Palliative Care kann auch bei einer chronischen Krankheit oder einem Krebsleiden vorübergehend ein Thema sein.
Beim Netzwerk wird Freiwilligenarbeit zum Thema Palliative Care geleistet. Das Netzwerk ist die kleinste Einheit der Regionalen Palliativ-Versorgung und besteht aus Vertretungen verschiedener Fachbereiche aus verschiedenen Gemeinden.
Warum braucht es das Angebot des "Palliative Cafés" vom Netzwerk Sempachersee?
Wir wollen das Thema unter die Leute bringen. Es kommt vor, dass die Strassenseite gewechselt wird, weil man nicht weiss, wie man mit einer kranken Person oder deren Angehörigen umgehen soll. In vielen Orten kennt man Trauercafés, wo man sich mit anderen Trauernden austauschen kann. Das Palliative Café geht in eine ähnliche Richtung. Das gibt es bisher noch nicht. Oft braucht es nur ein Gespräch oder man kann einen Kontakt herstellen. Es ist einfach wichtig, dass die Leute nicht allein sind. Ich arbeite bei der Spitex und sehe es in meiner täglichen Arbeit: Alles ist normal und plötzlich kommt eine Diagnose. Man ist in einem Ausnahmezustand. Wie übermittelt man die Krebsdiagnose seinen Kindern? Wie gehe ich als Patient mit der Diagnose um? Wie gehe ich als Angehöriger damit um? Wie geht man auf jemanden zu, der sich wegen Krankheit und Schmerz zurückzieht. Das ist überwältigend. In so einem Zustand ein Netzwerk aufzubauen und Hilfe zu suchen, ist schwierig. Das Palliative Café ist offen für alle, die mit dem Thema konfrontiert sind: Patienten, Angehörige, Nachbarn, Freunde etc.
Was sind die häufigsten Fragen betreffend Palliativ-Pflege, die an Sie herangetragen werden?
Wie sage ich es den Kindern? Wie gehe ich mit der Krankheit um? Wir helfen auch bei der Übersetzung der Diagnose. Im Spital wird immer «heilend» gedacht. Manchmal gibt es keine Heilung. Dann kommt die Palliativ Care ins Spiel: Wie kann man am besten helfen? Wie eine gute Zeit gestalten?
Warum braucht es das Palliativ Netzwerk Sempachersee?
Es braucht das Netzwerk, um das Thema in die Gesellschaft zu bringen und das Verständnis für das Thema zu wecken. Wir haben heute das System ambulant vor stationär. Die Patienten werden heute viel früher nach Hause entlassen und die Krankheit verlagert sich ins Haus, in die Gesellschaft. Zudem kommen nun die Babyboomer ins Alter. Das sind grosse Herausforderungen für die ganze Gesellschaft und für uns Pflegende.